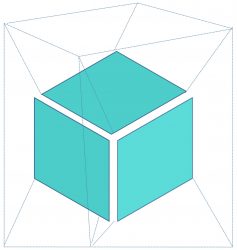Kunstschaffende brauchen Jahre, oft auch Jahrzehnte, um ihren eigenen Stil zu finden. Das ist durchaus ein schwieriges Unterfangen. Frühes Ausprobieren verschiedener Kunstrichtungen ist dabei so etwas wie ein Experimentieren mit unterschiedlichen Werkzeugen. Da hilft es enorm, wenn schon einmal ein reichlich bestückter Werkzeugkasten im Elternhaus vorhanden ist. Das war in der Künstlerfamilie der Giacomettis der Fall. Der kleine Alberto hat mit Vater Giovannis Tinten, Federn, Ölfarben und Pinseln früh angefangen, sich auszuprobieren. Eltern, der kleine Bruder, Landschaften, Posen vieler Verwandten und Bekannten sowie jegliche Gegenstände wurden zu Objekten des Skizzierens für den Jugendlichen. Schule war nicht wirklich interessant, selbst die École des beaux arts in Paris erweiterte zwar sein Repertoire an Techniken und Sichtweisen, aber auf dem Weg der Selbstfindung scheint es nur eine Passage gewesen zu sein. Auf dem Weg der Abstraktion hat Paris allerdings die Kreativität stimuliert. Seine Skulpturen von Köpfen der Familie haben sich verallgemeinert, hin zum Universellen. Weit über seine Heimat hinaus sagen die Skulpturen des späteren Albertos uns etwas über Menschheit und Menschheitsgeschichte. Den Weg zu verstehen, den der „L‘homme qui marche“ bis zu seiner Verwirklichung beschritten hat, ist in der Ausstellung im Bündner Kunsthaus nachvollziehbar. Vielleicht mehr ein Lehrstück in Pädagogik und Kunstpädagogik, als in grandiosen Werken der Giacomettis. Welch ein Glück, dass sich Alberto von den Stilrichtungen anderer abgesetzt hat und einfach sein eigenes Ding gemacht hat. Beruf und Berufung können nahe beieinander liegen. Das ist die gute pädagogische Message.