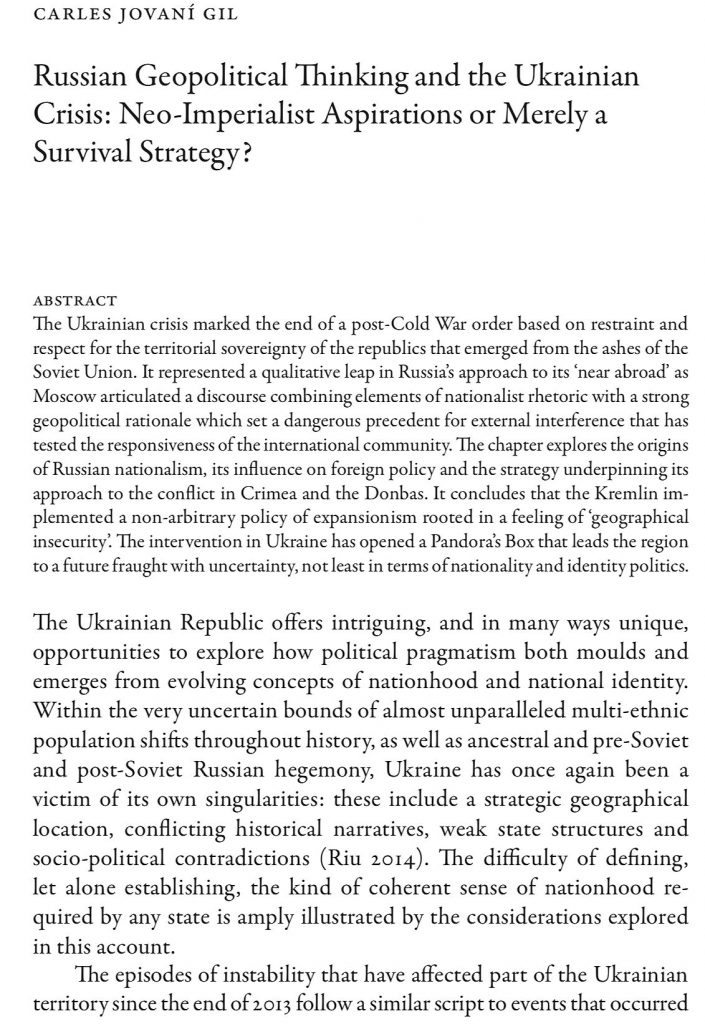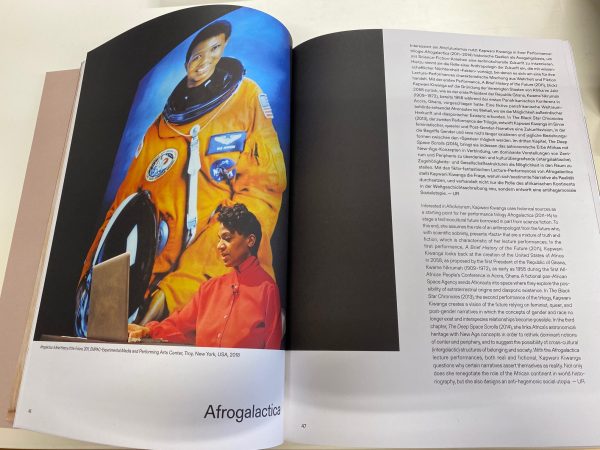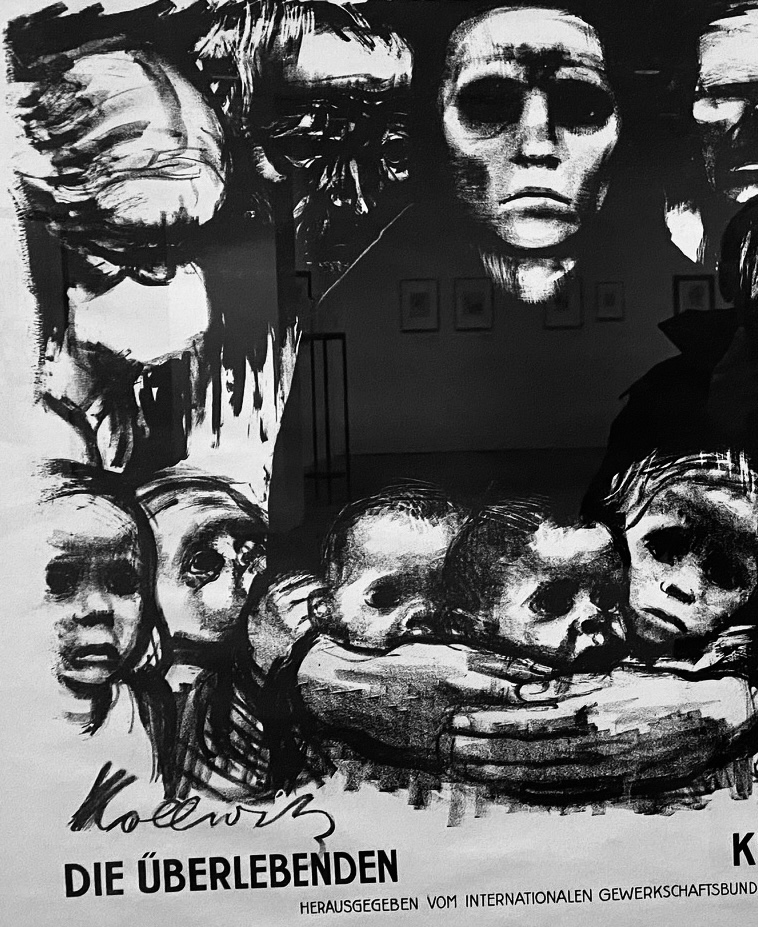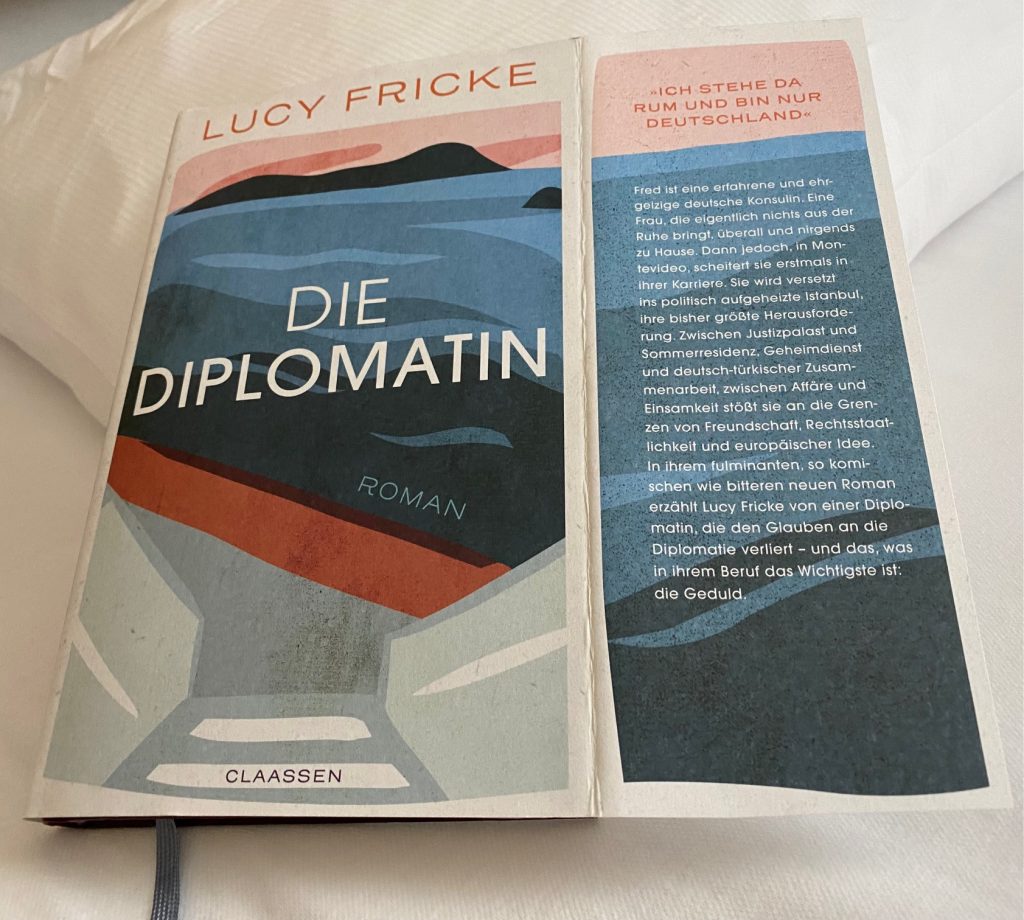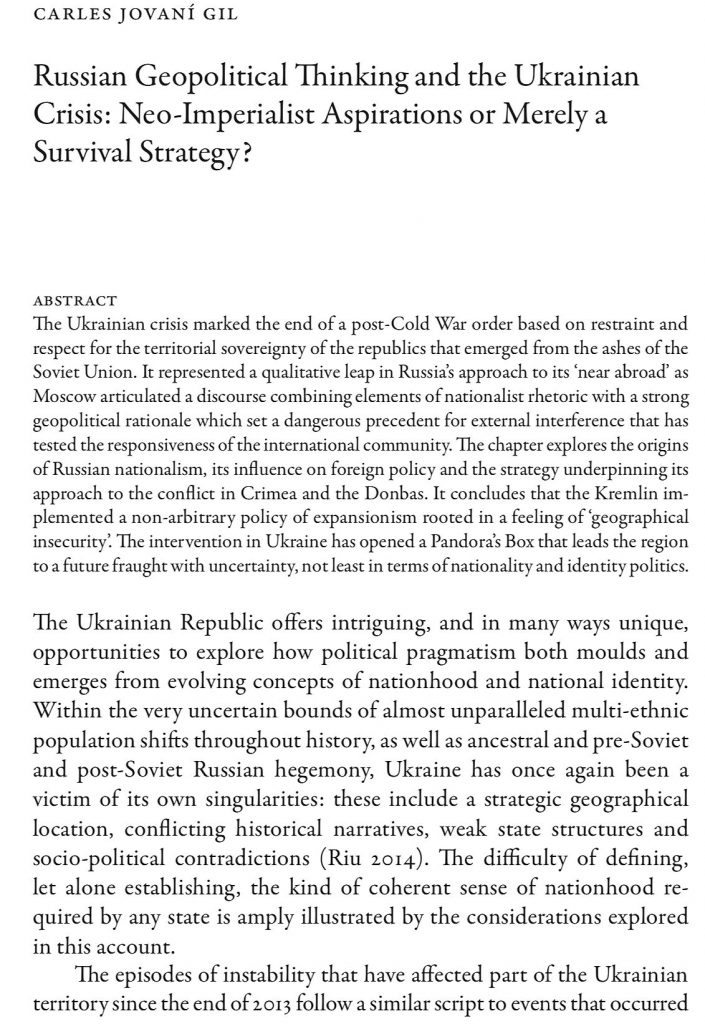Hugh Smith von der „School of Humanities and Social Science” der Australischen Akademie der Streitkräfte überschreibt sein letztes Kapitel im Buch „On Clausewitz“ von 2005 „Farewell to Clausewitz?“. Das Fragezeichen signalisiert die Zweifel, ob Clausewitz nicht weiterhin für uns auch am anderen Ende der Welt eine wichtige Lektüre bleibt. Mit der Verfügbarkeit von Atomwaffen dachten einige Strategen, Abschreckung durch Nuklearwaffen würde neuerliche Kriege als Fortsetzung von Politik verbieten, aber Smith (2005, S.244) argumentiert, die Bedeutung von Clausewitz ist sogar größer geworden, denn die Notwendigkeit zu verstehen, wie Krieg und Politik miteinander verbunden sind, ist größer denn je. Michael Howard wird sogar mit dem Ausspruch zitiert: „We are all Clausewitzians now“ (S.257). Neben einer Ableitung von für das Militär notwendigen Qualifikationserfordernissen (S.264) erinnert er an die Überzeugung von Clausewitz, dass Staaten zum Mittel des Krieges greifen werden, „if the prize is worth it“ (S.266). Clausewitz war in den Worten von Hugh Smith (2005, S.271) hilfreich: „Modern war, used cautiously and carefully as an instrument of policy, avoids the worst though it does not promote the best”. Aus einer historischen und philosophischen Perspektive heraus, unter Berücksichtigung der „analyse clausewitzienne“, schreibt Hugh Smith: „No paradigm of war is right or wrong. It is a matter of how humanity collectively chooses to interpret war. Clausewitz offered a powerful interpretation of war based on the state and its capacity for rational pursuit of national interests that became the dominant- though not undisputed – paradigm for understanding war in Europe… “.
Gallie (1978) bleibt eine wichtige Referenz zum Thema Krieg und Frieden. Anders als Tolstoi hat sein Buch den Titel Philosophers of Peace and War“. Die von ihm gestellte Frage lautet: Wie sollten gute Außenbeziehungen eines Staates aussehen? (S. 141). Die Liste der zu konsultierenden Autoren reicht von Kant, Clausewitz, Marx, Engels bis zu Tolstoi. Abschließend stellt Gallie sich und wir uns die Frage, wann ist der Einsatz von Gewalt gerechtfertigt? Damit erweitert sich das Spektrum der Fragen allerdings erheblich.
Das Werk von Carl von Clausewitz hat eine beträchtliche Zahl von Analysten auf allen Kontinenten hervorgebracht. Mit dem neuerlichen Krieg in Europa in der Ukraine hat sich die 200-jährige Wirkungsgeschichte (Durieux, 2008, S.21) nochmals verlängert. Wichtig ist die Auseinandersetzung mit Clausewitz im deutsch-französischen Verhältnis, denn nur so können wir die Bedeutung des Politischen betonen und alles daransetzen, dass es zu keiner Austragung von Konflikten mit militärischen Mitteln mehr kommt. Anders ist es mit der Rezeption von Clausewitz in Russland. Jacobs (1969) hat sich intensiv mit dem russischen Militärstrategen Frunze befasst, der mit einer Grabrede von Stalin gewürdigt wurde. Allein diese Tatsache lässt uns schon zusammenzucken. Der Name Frunze ist in der Militärstrategie verbunden mit dem Begriff der „proletarischen Militärdoktrin“. Der Kommentar von Jacobs zu dieser Strategie ist ernüchternd. Bei der proletarischen Militärdoktrin handelt es sich vornehmlich um eine ritualisierte, im Gegensatz zu einer realistischen Militärdoktrin. In einer solchen vereinigten Militärdoktrin werden Staatsziele, militärische Konzepte, lokale Besonderheiten and „skills“, zusammengeführt und übertragen auf militärische Belange. Frunze wird zitiert mit: „‘unified military doctrine‘ is the aggregate of military attainments and military bases, of practical methods and national skills which the country considers best for a given historical moment and which permeate the military system of the state from top to bottom. Aus dieser Langzeitsicht erklärt sich dann eventuell der “ritualisierte” Nazivergleich von Putin mit Bezug auf die Ukraine als der ewige Feind des Bolschewismus sowie die lokale Verbundenheit mit Teilen der Ukraine als ureigener Teil der größeren, russischen Heimat. Es stehen sich dementsprechend in der Ukraine eine ritualisierte Militärdoktrin einer auf Realpolitik basierenden Militärstrategie gegenüber. Was bleibt? Diplomatie als realistisches und strategisches Ritual bleibt der Ausweg aus der Krise. Krim-Sekt mit Putin? Geschmacklos ja, aber wenn es dem Frieden dient, vielleicht doch nötig?
Hintergrundliteratur: CARLES JOVANÍ GIL S.203-222. in “Pulling together or pulling apart? Perspectives on Nationhood, Identity, and Belonging in Europe” by Belenguer and Brady (eds.) 2020.